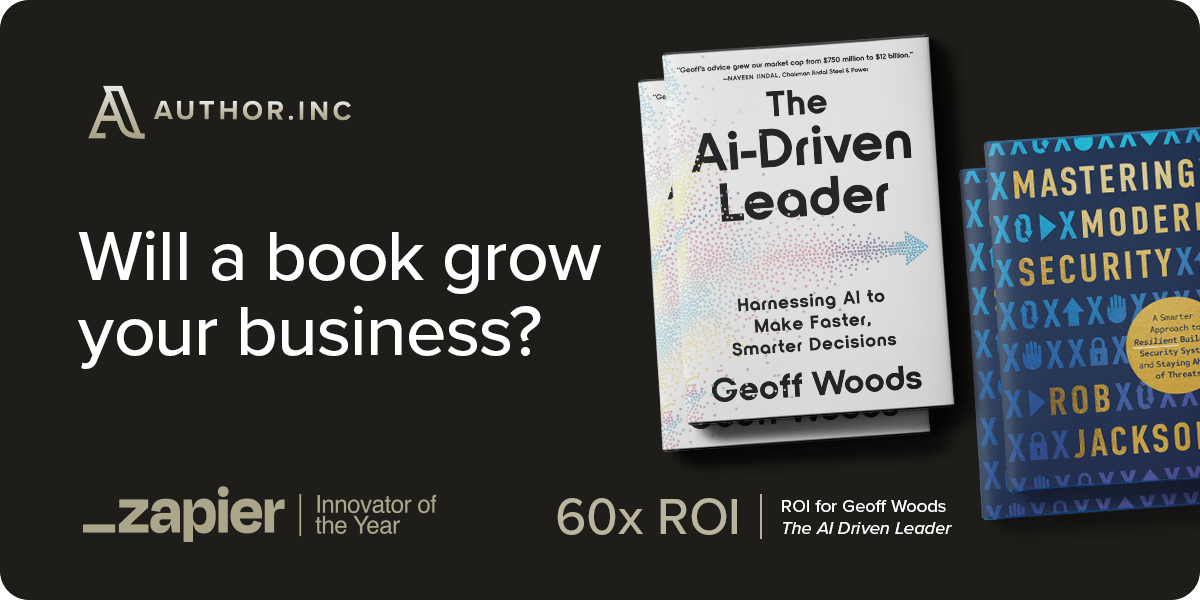Jennifer Brandel auf dem Campus der Stanford University
Jennifer Brandel ist vor allem als Gründerin und CEO von Hearken bekannt, einer Plattform für Audience Listening, die sich vor zehn Jahren aus dem Call-in-Format „Curious City” beim Chicagoer öffentlichen Radiosender WBEZ entwickelt hat. Die Radiosendung und später Hearken waren Vorreiter für Publikums-Engagement.
Es war ein fundamentaler Paradigmenwechsel: Journalisten beziehen Nutzer ein, indem sie nicht mehr in Form von Artikeln oder Kanälen als Produkten denken, sondern vielmehr in Form von kontinuierlichen Prozessen, die einen konstruktiven Dialog unterstützen – unabhängig davon, ob daraus ein Artikel, eine Sendung oder eine Bürgerversammlung entsteht.
Die Erfolgsparameter veränderten sich von Auflagenzahlen, Einschaltquoten oder Klickzahlen zu Vertrauen, Relevanz, zahlenden Mitgliedern und nachhaltigen Publikumseinnahmen. Seit 2015 hat das Unternehmen mit 300 Redaktionen zusammengearbeitet – von der BBC bis zu winzigen Redaktionen in der texanischen Provinz.
Jetzt hat Brandel das Tagesgeschäft von Hearken an ihr Team übergeben, um sich als Knight Fellow an der Stanford University auf die Erforschung innovativer Engagement-Modelle für das Publikum zu konzentrieren. Ihre Vision: neue Wege zu finden, wie Journalismus in einer Ära überleben kann, in der KI vertrauensvolle menschliche Beziehungen zu ersetzen droht.
Diese Woche habe ich Brandel mit einer Gruppe deutscher Chefredakteure und Medienmanager getroffen (die Chefrunde Study Tour, die ich mitorganisiere). Sie hat uns ihre Vision von Publikums-Engagement im Zeitalter der KI erklärt und mit uns darüber diskutiert. Dieser Beitrag basiert auf unserem Treffen.
Im Kern von Brandels Ideen steht ein Reframing: Sie nennt es AE statt AI – tatsächliche Erfahrung (Actual Experience) statt künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence).
Konsum ist nicht Engagement
Wenn Brandel über Engagement spricht, lehnt sie ab, was die meisten in der Medienbranche unter dem Begriff verstehen. Klicks, Shares, Likes, Reposts: „Das ist Konsum. Das ist nicht, was ich meine, wenn ich über Engagement spreche.”
Brandel definiert Engagement als den Aufbau einer gegenseitigen, responsiven Beziehung auf menschlicher Ebene. Nicht Menschen als Datenpunkte, sondern als komplexe Individuen, die Journalismus gemeinsam mit Journalisten gestalten. Das bedeutet, voneinander zu lernen und sich gemeinsam mit den Menschen weiterzuentwickeln, denen eine Redaktion dient.
Dieser Ansatz entstand aus ihrer Zeit als Reporterin bei WBEZ in Chicago. Sie erkannte, dass das Design des Journalismus ein unvollkommenes System schafft: Eine Redaktion versucht, eine ganze Stadt zu bedienen, aber nur Menschen mit einem schmalen Erfahrungsband treffen die redaktionellen Entscheidungen. Der Prozess, den sie entwickelt hat, fragt: Welche Fragen habt Ihr, die wir für Euch untersuchen sollen? Keine Meinungen, keine Tipps, sondern echte Informationslücken, bei denen Leute etwas suchen und nichts finden oder nur Informationen finden, die sie nicht verifizieren können.
Wenn 10 Leute merken, dass etwas nicht stimmt
Brandel beschreibt, wie dieses Modell in der Praxis funktioniert. Während einer Woche bei WBEZs “Curious City”-Serie meldeten sich circa zehn Leute und fragten, warum Trinkbrunnen in den Parks von Chicago rund um die Uhr liefen. „Sie fragten sich, warum verschwenden wir Wasser in den Trinkbrunnen? Das ist doch seltsam”, erinnert sich Brandel.
Die Reporter recherchierten. Sie entdeckten, dass die Park-Behörde Wasser durchspülte, weil die Bleiwerte so hoch geworden waren, dass Beamte versuchten, die Giftkonzentrationen auf vorgeschriebene sichere Standards zu senken. Die Behörde machte die Öffentlichkeit nicht auf die erhöhten Werte aufmerksam, ließ aber die Trinkbrunnen kontinuierlich laufen.
Diese Frage war der Anfang einer Story, die sich in Chicago seit acht Jahre fortsetzt: Wo sind Bleirohre? Wo wurden sie ersetzt? Was sind die Hintergründe der Infrastrukturkrise? Chicagos Bürgermeister Rahm Emanuel entschied sich, bei der Wahl nicht mehr anzutreten – teilweise wegen der Kosten für den Austausch aller Bleirohre. „Und das wurde von unserer kleinen Lokalserie aufgedeckt, nur indem wir fragten: Worüber wunderst Du Dich?”, sagt Brandel.
Die Story begann mit einer Frage von Bürgern, die in ihrem Alltag etwas Merkwürdiges bemerkten. Sie endete in Accountability-Journalismus, verwurzelt in den Alltags-Erfahrungen der Menschen, denen die Redaktion dient.
Gesponsert
Will A Book Grow Your Business?
No one buys a beach house from selling a book. They buy the beach house from the opportunities the book gets them.
Author.Inc helps experts, executives, and entrepreneurs turn expertise into world‑class books that build revenue, reputation, and reach.
Their team—behind projects with Tim Ferriss and Codie Sanchez—cuts through uncertainty to show whether your book can realistically hit those targets.
Schedule a complimentary 15‑minute call with Author.Inc’s co‑founder to quantify potential ROI from your offers, speaking engagements, royalties, and more.
This isn’t writing advice. It’s a strategic consultation to decide whether now is the right time to put pen to paper.
If it’s a go, they’ll show you how to write and publish it at a world-class level. If it’s a wait, you just avoided wasting time and money.
Mit relevanten Fragen überrollt
Das Modell kann sich dramatisch skalieren lassen. Als die BBC Hearken-Embeds in fünf Auslandsredaktionen einsetzte, darunter in Afrika, Indien und in Sportredaktionen, testeten sie eingebettete Modul unter Live-Bedingungen. Direkt nachdem der Brexit 2016 bekannt wurde, platzierten sie ein Embed auf ihrer Website und baten um Fragen.
Sie erhielten 1.600 Fragen in den ersten zwei Stunden.
Die BBC nahm das Embed wieder herunter, weil sie genug Informationen hatten, von denen sie einige nie bedacht hätten. Alle BBC-Reporter hatten die britische Staatsbürgerschaft. Aber die Fragen offenbarten Perspektiven, die sie übersehen hatten: Was bedeutet der Brexit für ausländische Mitbürger?
Die BBC konnte in dieser ersten Stunde eine starke FAQ-Übersicht erstellen. Das Volumen zeigte sowohl das starke Interesse an dieser Art von Journalismus als auch die Informationslücken, die selbst bei der umfassenden Brexit-Berichterstattung existierten.
Wie KI Beziehungen bedroht
Brandel sieht KI als etwas Entmenschlichendes, das langjährige dauerhafte Beziehungen durch unmittelbare Transaktionen ersetzt. „Es multipliziert unseren Grad an Transaktionalität exponentiell”, sagt sie.
Diese Sorge ist empirisch begründet. Eine 2025 veröffentlichte Studie fand heraus, dass KI-generierter Journalismus zwar allmählich an Akzeptanz gewinnt, das Vertrauen aber deutlich steigt, wenn Inhalte klar gekennzeichnet sind und ethisch überwacht werden. Human in the Loop bleibt entscheidend für Authentizität und emotionale Tiefe. Die Studie betont, dass für Vertrauen nicht nur faktischer Genauigkeit entscheidend ist, sondern auch Transparenz über den Entstehungsprozess.
Eine andere Studie von 2024 fand heraus, dass nur 23% der Amerikaner glauben, dass überregionale Medienunternehmen die in erster Linie die Interessen der Öffentlichkeit wahrnehmen. Content-Creator, die direkte Beziehungen zu ihrem Publikum aufbauen, indem sie mit ihm reden, genießen oft mehr Vertrauen als institutioneller Journalismus.
„KI ist wie Feuer”, sagt Brandel. „Es kann benutzt werden, um Dörfer niederzubrennen. Oder es kann benutzt werden, um dein Abendessen zu kochen. Es hängt wirklich davon ab, wie du es einsetzt.”
Sie befürchtet, dass Redaktionen KI nutzen werden, um die aufwendigere Beziehungsarbeit zu erledigen, damit sie mehr Content produzieren können. „Ich kenne niemanden, der sagt: Ich brauche mehr Content”, sagt sie. „Sie sagen: Ich brauche mehr relevante, nützliche Dinge für mein Leben, nicht: Es gibt nicht genug Informationen in der Welt.”
Eine klare Grenze für den KI-Einsatz ist laut Brandel: An welchem Punkt schwächt Du durch den Einsatz von KI die Beziehungen, die du mit den Nutzern aufbaust, und ihre Beziehungen untereinander?
Medien weniger vertrauenswürdig als Anwälte
In den USA genießen Medien jetzt weniger Vertrauen als Anwälte, bemerkt Brandel. Studien wie der Reuters Digital News Report 2024 zeigen immer wieder, dass die meisten Menschen ähnlich darüber denken, was Nachrichten vertrauenswürdig macht: Transparenz, hohe Standards, Freiheit von Voreingenommenheit und faire Behandlung von Menschen.
Aber viele haben das Gefühl, dass sie das nicht bekommen. „Du wirst nicht dahin kommen, indem du sagst: Diese Story wurde von KI ermöglicht”, sagt Brandel. Vertrauen aufzubauen erfordert Menschen, die mit der Öffentlichkeit auf verkörperte Weise interagieren. „Es ist keine skalierbare Lösung. Es ist nicht sexy, aber es ist dauerhaft und wiederholbar.”
Neugier als unendlich erneuerbare Ressource
Brandel identifiziert drei zentrale Erkenntnisse aus zehn Jahren Community-getriebenem Journalismus:
Neugier ist eine unendlich erneuerbare Ressource, die jeder hat. Sowohl Kleinkinder als auch 100-Jährige können sich engagieren, indem sie Fragen stellen. Fragen sind zugänglich. Du musst kein Experte sein oder einen geheimen Tipp haben.
Wenn Menschen sich in Berichten wiedererkennen und genannt werden, werden sie zu natürlichen Multiplikatoren, die man mit Geld nicht kaufen kann. „Jemand ist in einer Story und sagt: Hey, ich habe eine wirklich gute Frage gestellt und diese Redaktion hat diesen Bericht darüber geschrieben”, erklärt Brandel. „Sie werden die Story in all ihren Netzwerken teilen und plötzlich werden Menschen, die deine Redaktion nicht kennen, sagen: Oh, mein Freund war in den Nachrichten, wie cool?”
Neugier generiert Einnahmen. Wenn Reporter zu Lead-Generatoren von E-Mail-Adressen werden, indem Menschen Fragen stellen, bauen Redaktionen ihre Mitgliederbasis auf. Reporter wandern von der Verlust- zur Gewinnseite der Bilanz.
Für kollektives Handeln designen
In Stanford denkt Brandel darüber nach, wie Journalismus anders funktionieren könnte. Sie fragt: Warum sind Nachrichten so gestaltet sind, dass wir sie als Individuum nutzen, wo doch die Probleme, vor denen wir stehen, kollektiv sind?
„Wie müssten Nachrichten oder journalistische Informationen für Kollektive gestaltet werden, die sie konsumieren, verarbeiten und für Handlungen nutzen, anstatt dass jeder Nachrichten auf seinen persönlichen Geräten bekommt und sich überfordert, entmutigt und nutzlos fühlt?“, fragt sie.
Sie stellt sich vor, dass Redaktionen sich von täglichen Updates wegbewegen und sie etwas altmodisches wie Wochenschauen wieder entdecken: samstags abends versammeln, um vier Stunden lang die wichtigsten lokalen Themen durchzugehen, sich in Diskussionsgruppen aufzuteilen, Menschen verbinden, die Interessen teilen. „Ich weiß, dass viele Redaktionen wahrscheinlich sagen würden: Das ist nicht unser Job, wir müssen neutrale Beobachter bleiben”, sagt sie. „Aber ich schaue aus einer praktischen Perspektive darauf, wie wir als Spezies Mensch überleben, nicht als Redaktion.”
Eine unzerstörbare Redaktion bauen
Brandels provokativste Idee: „Wie könnte man eine unzerstörbare Redaktion bauen? “Die Antwort ist paradox, denn es ist wahrscheinlich keine Redaktion.”
Um eine unzerstörbare Redaktion zu schaffen, schlägt sie vor, sich vom Konzept eines zentralisierten Unternehmens zu lösen. „Es ist eher ein verteiltes Netzwerk aus vertrauensvollen Beziehungen, über das Menschen Informationen teilen, das vielleicht auf andere Weise monetarisiert werden muss.”
Das bedeutet, dass Journalismus sich möglicherweise mit gesellschaftlich verankerten Institutionen wie Bibliotheken, Bildungseinrichtungen und Community-Action-Organisationen zusammentun sollten . „Wird Journalismus mehr zu einer Teamsportart, zu einem Netz von Gleichberechtigten anstatt einer zentralen Anlaufstelle?”
Traditionelle Medien haben dabei besondere Probleme, argumentiert sie. Für kleine wendige Startups, die von vornherein in Communities denken, hat sie mehr Hoffnung. Aber die grundlegende Frage bleibt: Wie kann Journalismus besser für gegenseitige Hilfe und Unterstützung genutzt werden, um nicht nur um zu berichten, was bei Meetings passiert ist, sondern um Menschen zu helfen, für sich selbst und ihre Nachbarn zu sorgen?
Zentrale Lektionen aus Brandels Ansatz:
Konsum ist nicht Engagement: Volumen-Metriken messen keine gegenseitigen Beziehungen, auf die es ankommt.
Fragen offenbaren Informationslücken: Zu fragen, was Menschen wissen wollen, produziert originelle Berichterstattung, die Lücken im journalistischen Ökosystem füllt.
Menschen werden zu Marketern: Wenn Nutzer sich selbst in Storys sehen, teilen sie diese Storys authentisch in ihren Netzwerken.
Reporter generieren Einnahmen: E-Mail-Adressen von Fragenstellern bauen Mitglieder-Pipelines auf.
Kleine Signale zählen: Zehn Menschen, die ununterbrochen sprudelnde Trinkbrunnen bemerken, können eine achtjährige Accountability-Story losbrechen.
Skalierung passiert schnell: Der richtige Impuls kann 1.600 Fragen in zwei Stunden generieren.
KI schwächt Beziehungen: Die Frage ist, wie Redaktionen Automatisierung nutzen können, um menschliche Verbindungen zu stärken.
Vertrauen erfordert Menschen: Journalisten, die mit Nutzern auf menschliche Weise interagieren, bauen dauerhaftes Vertrauen auf, das Metriken nicht erfassen können.
Kollektiver Medienkonsum nötig: Berichte, die für individuellen Konsum gestaltet sind, können kollektive Probleme nicht lösen.